Und mehr, als bereits in der Überschrift steht, lässt sich eigentlich nicht sagen.
Unerwartet still kommt das erste Lebenszeichen von Christopher Nolans nächstem Streich daher. Noch ein Jahr.
Autor: Martin
Edge of Tomorrow – Der erste Trailer
Nun schon der dritte potenzielle Blockbustertrailer in drei Tagen. Dieses mal ist’s die Premiere der Edge of Tomorrow-Vorschau, mit der Cruise seiner wiedergefundenen SciFi-Linie nach Oblivion die Treue hält.
Offenbar möchte der Film quasi alles auf einmal sein. Seien wir gespannt, wie er es sich nimmt.
Godzilla – Der Trailer ist da
Nach der Geheimniskrämerei um den Teaser, ist nun still und leise der Trailer zur x-ten Neuinterpretation von Godzilla im Netz aufgetaucht.
Und man mag es gar nicht glauben, aber er ist gut und scheint tatsächlich etwas Neues vom Alten zeigen zu wollen.
Doch seht selbst.
Jupiter Ascending – Erster Trailer
Gäbe es nicht Matrix, die Geschwister Wachowski wären, wenn überhaupt, wohl nur einem elitären Kreis aus Allessehern ein Begriff. Doch es gibt Matrix nun mal und obwohl es auch die Fortsetzungen von Matrix gibt, haftet dem Familiennamen immer noch eine Aura von Innovation und Durchsetzungsvermögen an. Dank diesen Filmen gibt es V wie Vendetta, Speed Racer, den schnell vergessenen Ninja Assassin und den großartigen Cloud Atlas.
An diesen Beispielen zeigt sich aber auch, dass die Filme nicht unbedingt besser werden, wenn die Wachowskis mehr Einfluss nehmen.
Wie dem auch sei, mit Jupiter Ascending scheint man ganz offensichtlich an die Erfolge früher Tage anküpfen zu wollen. Dem Trailer könnte man spitz vorwerfen, er vermittele den Eindruck, als hätte man das Schlechteste aus Matrix und Cloud Atlas in einen Topf gewürfelt, um es dann auf niedrigster Flamme zu erwärmen.
Aber was sind schon Trailer. Und auch das Schlechteste aus beiden Filmen muss nicht heißen, dass am Ende etwas tatsächlich Schlechtes herauskommt.
Attack the Block
Joe Cornish war das, was gefühlt die Hälfte aller US-Bürger ist, Comedian. Neben unbedeutenden Rollen in Filmen, die ihn in Kontakt mit Nick Frost brachten, schrieb er Drehbücher fürs TV und brachte auch ein paar Belanglosigkeiten in Eigenregie auf die Mattscheibe.
Kein heller Stern also. Doch seine nächsten Projekte lauten Die Abenteuer von Tim und Struppi – Das Geheimnis der Einhorn und Ant-Man, als Autor bzw. Co-Autor.
Und dazwischen? Dazwischen kam Attack the Blog, wo er sowohl für die Geschichte als auch für deren Umsetzung verantwortlich war.
This is too much madness to explain in one text!
Story
Ein sozialer Brennpunkt in London, wo Gang-Rivalitäten – meist wegen Drogen – nicht selten bis zu Schießereien hochkochen, wird Schauplatz einer kleinen Alieninvasion mittels Meteoritenschauer. Klein, weil eigentlich nur ein paar struppige Biester in der englischen Hauptstadt aufprallen. Klein, das denken sich auch Moses und seine Gang aus kleinkriminellen Jugendlichen, die prompt zur Treibjagd blasen – schließlich kann niemand einfach so in ihren Block eindringen und Unheil stiften. Aauch keine Außerirdischen.
Nicht nur ist die von den schwarzen Space-Hunden ausgehende Bedrohung weitaus größer, als kalkuliert, plötzlich tauchen auch noch die Polizei und der wütende Drogenzar des Viertels auf und alle wollen sie dem Fünfköpfigen Freundeskreis an den Kragen. Zusammen mit der sich unfreiwillig anschließenden Krankenschwester Sam flüchten sie zurück ins das Reich ihrer Sozialwohnungen, um einen Gegenangriff zu planen.
Kritik
Anfangs darf man skeptisch sein. Schon wieder irgendwelche animalischen Aliens, die keine Ziele haben, außer ihre Zähne in Fleisch zu tauchen. Schon wieder eine Gruppe von Leuten, die über sich hinauszuwachsen hat. Schon wieder in irgendeinem englischen Ghetto.
Gut, ein „schon wieder“ zu viel, denn das Ghetto ist neu. Oder, um es etwas kategorischer auszudrücken, die Verbindung von Science-Fiction-Film und Milieustudie ist neu und ein ziemlich schräger Einfall dazu.
Damit schafft sich Attack the Block gleich jede Menge Probleme, die insbesondere für einen mit Produktionen dieser Größe recht unerfahrenen Mann wie Herrn Cornish kein Zuckerschlecken gewesen sein dürften. Allen voran: Wie gelingt es, dass die 15-jährigen Kinder unterster Schicht mit ihrer Attitüde und dem Hip-Hop-Humor nicht nerven, sondern im Gegenteil als taugliche Hauptfiguren funktionieren – ohne dabei an Authentizität einzubüßen?
Normalerweise ist die kleine Gang aus vorlauten Kindern in Horrorfilmen dafür geeignet, sich für den Schrecken der Exposition zu opfern und dann nie wieder erwähnt zu werden. Hier wird die Einleitung aber überlebt und man schlägt sich durch die ganze Geschichte. Und das auf eine ganz eigene Weise.
Tatsächlich meistert der Film diese Probleme sehr geschickt und beschert einen Culture-Clash der ultimativen Sorte, der der Invasionsthematik frischen Drive gibt.
Das beginnt schon damit, dass die Halbstarken ihr erstes Alien, das sie mit einer Silvesterrakete erlegt haben, stolz und randvoll mit empfundener Coolness einmal quer durch die Stadt schleifen, in erster Linie aber Fifa spielen wollen. Dass die Neuankömmlinge vielleicht gar nicht so böse sein könnten (oder aber zu böse), wird in keinem Augenblick erwägt. In Folge haben sie, als sie auf das erste Geschöpf mit wirklichem Biss stoßen, nur noch Verbarrikadieren im Sinn.
In Sachen Witz pendelt man irgendwo zwischen semi-authentischem Block-Geblubber und einer schillernden Ladung kultureller Anspielungen auf Film und Vorurteil. Manches davon geht ins Leere bzw. ist einfach etwas zu gewollt, im Schnitt macht Attack the Blog aber mächtig Laune.
Durch die neue Genrewürzung ist nicht nur das Verhalten der Figuren ungleich mit dem normaler Sci-Fi-Heroen, auch die Art, wie das Ganze gefilmt wurde, unterscheidet sich immens vom Durchschnitts-ET. Alles ist etwas kleiner, näher am Charakter und unaufgeregter, nicht aber weniger intensiv.
Nick Frost als für sein Wesen viel zu alter Verlierer mit schulterlangen, fettigen Haaren, ist eine nette Dreingabe mit mikroskopisch kurzer Screentime, die für den Film mehr Werbung denn Plotbereichung ist. Aber lieber wenige kurze Szenen mit Nick Frost als Marihuanagärtner als gar keine.
Gleiches mit dem menschlichen Bösewicht. Er wirkt in seinem ganzen Tun etwas müde konzipiert, funktioniert im Gesamtbild der Stimmung ganz gut, hat aber eigentlich überhaupt keine wirkliche Funktion, sondern ist nur ein fauler Versuch, ein zusätzliches Suspense-Element miteinzubauen.
Beim Design der außerirdischen Kreaturen orientiert man sich gerne an Bekanntem, dafür sind die eigenen Ideen ein bisschen halbgar geworden. Trotzdem muss man hier Loben, was auch in vielen anderen Bereichen des Filmes hervorzuheben ist: Lieber klein, wenig und dafür richtig, als groß, zu dick aufgetragen und am Ende zu sperrig, um mit der Dramaturgie vereinbar zu sein.
Fazit
Aber wenn nicht alle Einzelheiten frisch sind, das Gesamtpaket ist es umso mehr. Die Verschnürung der beiden einander doch sehr unähnlichen Genres sorgt für ein kurzweiliges Spektakel, das gut gefilmt und gut gespielt ist, launige Momente hat, frech daherkommt und zum Schluss seinen jugendlichen Nachwuchsgangstern einen Gefallen erweist, indem das Finale einfach schweinecool ist.
The Amazing Spider-Man 2 – Erster Trailer
Ja, in den letzten Wochen überschlagen sich die Posts nicht. Der Dezember verlangt Weihnachten und Weihnachten verlangt Opfer. Selbst in der Zukunft, so wie’s aussieht.
Apropos Zukunft, mit der hat Spider-Man immer noch nicht so richtig was zu tun. Aber „Science-Fiction“ ist ja auch genaugenommen gar nicht zwingend Zukunft. Und außerdem gibt’s sowohl zu Raimis erstem Netzschwinger als auch zum gar nicht so furchtbar unnötigen Reboot bereits eine Rezension in diesen Hallen.
Warum also nicht der der Trailer zum zweiten zweiten Teil mit der freundlischen Spinne aus der Nachbarschaft. Ausnahmsweise geht es mal um „his greatest battle“. Leider merkt man dem Spaß seine Computerherkunft überdeutlich an, sodass die Sache aktuell mehr nach Computerspiel oder Animationsfilm aussieht.
It’s all about Love
Thomas Vinterberg ist neben Lars von Trier der wohl bekannteste Mitbegründer der Dogma-95-Bewegung. Sein erstes richtiges Projekt nach seinem Erfolg von Das Fest war dann gleich ein internationales, das wie so häufig nie so richtig bekannt wurde. Mit It’s all about Love hat es der Däne seinem Publikum aber auch nicht leicht gemacht.
I don’t want to fly. We are not Angels. We are human beings.
Story
John will im Jahre 2021 eigentlich nur kurz in New York zwischenlanden, damit seine Ex-Frau, die weltberühmte Eiskunstläuferin Elena, die Scheidungspapiere unterschreiben kann. Am Flughafen trifft er nicht sie, sondern zwei Anzugträger, die John in ihrem Auftrag dazu anhalten, sie zu begleiten, denn Elena sei verhindert, da sie am gleichen Abend eine Premiere habe.
Der Kurze Zwischenstopp weitet sich auf mehrere Tage aus, als John feststellt, dass irgendetwas Eigenartiges im Gange zu sein scheint. Die Idylle, die die Familie seiner Ex-Frau ausstrahlt, zeigt deutliche Risse, ja, die gesamte Umgebung strahlt Unheimliches aus und die psychisch labile Elena immer wieder ängstlich deutet an, sich in großer Gefahr zu befinden.
Dies alles geschieht in Zeiten sonderbaren Wandels. In Uganda fangen die Menschen plötzlich an zu fliegen, an einem Tag im Jahr gefriert sämtliches Süßwasser und überall auf der Welt sterben die Leute an gebrochenem Herzen.
Kritik
Von einem Film, in dem unter anderem Joaquín Phoenix, Claire Danes, Sean Penn und Marc Strong mitspielen, darf man wohl zu Recht eine erstklassige Darbietung der Mimen erwarten. Ein Film, der It’s all about Love heißt, schürt aber auch Erwartungen in eine andere Richtung. Sie alle werden erfüllt. Geboten wird nicht nur tolles Spiel, sondern auch ein sehr experimentelles Grundkonzept mit ungewöhnlichem Drehbuch, expressivem Bühnenbild und inszenatorischer Raffinesse. Doch verliert der Film bei seiner Liebe zum Außerordentlichen nicht nur seine Geschichte aus den Augen, sondern zunehmend auch die Bodenhaftung.
Der Anfang ist eine Freude. Eine sonderbare Grundstimmung in einer sonderbaren Welt und eine der unheimlichsten Szenen jüngerer Filmgeschichte. Das sehr eigene Kompositum aus skurrilem Humor, Gruselstimmung und zynisch-dramatischen Bildern von Toten auf der Straße lässt am ehesten den Eindruck einer Satire entstehen. Und eine Satire ist It’s all about Love auch, allerdings eine, die bitterer als heiter ist und mit viel Symbolik und Theatralik daherkommt.
Mit seiner bedeutungsschwangeren Art treibt es der Film gerne auch zu weit. Das ist über weite Strecken nicht schlimm, denn vor allem anderen ist die dystopische Liebesgeschichte ein inszenatorisch ungeheuer erhebendes Stück Wertarbeit, gegen Ende öffnet sich die Kluft zwischen Anspruch und Ergebnis aber immer weiter.
Bis dahin ist es aber eine Freude, dabei zuzusehen, wie der Film fast schon spielerisch hin und her hoppst zwischen Mystery, Grazie und Drama und dabei scheinbar mühelos jederzeit stringent und in sich schlüssig wirkt, während die einzelnen Stimmungen, die einander eigentlich so fremd, ineinander aufgehen. Das spiegelt sich auch auf klanglicher Ebene wieder, wenn immer wieder zärtliche Harmonien Zbigniew Preisners auf unheilvolles Dröhnen gelegt werden, beide Spuren einander aber nicht bekämpfen, sondern sich in spezieller Weise aufeinander beziehen.
Das alles sind Dinge, die ziemlich gut darüber hinwegtäuschen können, dass Thomas Vinterbergs Sci-Fi-Fabel kaum Geschichte und Substanz hat. Ja, es passiert viel. Da wird immer mal wieder weggerannt und dann sofort wieder intrigiert, Nachrichtenausschnitte geben Kostproben von globalen Merkwürdigkeiten, komische Gestalten halten komische Ansprachen, man sieht einiges an Eiskunstlauf und regelmäßig finden die Liebesspiele zwischen John und Elena an diversen Örtlichkeiten statt. Doch ist die Geschichte selbst verhältnismäßig dünn und kommt kaum voran. Das macht den Film nicht kaputt, denn unterhaltsam ist er aufgrund seines perfektionistischen Stils und dem ganzen Hin und Her in Sachen Details- und Stimmungen ja schon, wünschenswert wäre es aber gewesen, wenn der eigentliche Erzählstrang mehr zu bieten hätte. So ist die Story nicht nur ziemlich schmächtig, sondern auch nur mäßig interessant ausgefallen. Schade ist außerdem, dass die durchgehend tadellose Ausführung zum Ende hin merklich nachlässt und das Geschehen darüber hinaus im letzten Viertel plötzlich sehr gehetzt wirkt, was dem Gesamteindruck einen kleinen Stoß versetzt. Wenn dann auch die unterschwellig sowieso schon immer drohende Theatralik auch noch die Überhand gewinnt, während Symbolträchtigkeit, Kitsch und künstlich aussehendes Schneegestöber aufeinanderprallen, dann können die vielen Schönheiten des Filmes das nicht mehr überdecken. Die formvollendete Kameraarbeit Anthony Dod Mantles (Dredd) tritt zu diesem Zeitpunkt ebenso die Talfahrt an, wie der Rest. Dieser akute Nachlass an Qualität ist derart augenfällig, dass man fast meinen könnte, es wäre Teil des Konzeüts – und zu Vinterbergs Dogma-95-Hintergrund würde das durchaus passen. Doch ganz davon abgesehen, dass er selbst seinen Film als Anti-Dogma-Werk betitelt, lässt es sich auch einfach nicht schönreden, was da geschieht.
Und dann ist da noch Sean Penn als Johns reisender Bruder, der Schriftsteller ist, aber eigentlich nur redet. Laut in Headsets redet, inmitten vollbesetzter Flugzeuge, Sätze sagt, die der Tiefe und der Wahrheit, die in der Liebe der Protagonisten liegt, Flügel geben sollen. Wer der Meinung ist, Penns Rolle in The Tree of Life sei überflüssig, der wird dies nach It’s all about Love wahrscheinlich noch mal überdenken. Terrence Malick ist übrigens ein wohl gar nicht so verkehrtes Stichwort, wenn man transportierte Gefühle, vor allem aber die Ambitionen des Filmes an einem Vergleich festmachen möchte. Nur unterscheiden sich Malicks Werke und It’s all about Love gravierend voneinander, wenn es um die Umsetzung dieser Ambitionen geht.
Zurück aber zu Johns Bruder. Sein großes Ziel ist es, einen Bricht über den Zustand der Welt zu schreiben. Und ja, dafür gibt es diese Figur, denn das möchte der Film – wie ja so viele Science-Fiction-Werke – gerne sein: Ein Bericht über den Zustand der Welt. Doch auch, wenn sicher viel Wahres in den kleinen und großen Problemen, die im Film auf mannigfaltige Weise thematisiert werden, so sollte ein solcher Bericht, wenn er Wahrheit für sich beansprucht, doch Abstand nehmen von zu viel Kitsch. Denn leider Gottes ist in dieser Welt für den wahren Nicht-Vorweihnachtskitsch einfach kein Platz.
Fazit
Auch wenn die tatsächliche Geschichte nur eine hauchdünne Membran zwischen Stimmung und Ästhetik ist, ist It’s all about Love in erster Linie interessant und durchaus kurzweilig. Es ist ein Essay über die moderne Gesellschaft, mit all ihren Tücken, Prioritäten und Begleiterscheinung, geschrieben in einer Sprache, die bisweilen arg pathetisch klingt und versetzt mit Metaphern, die zu oft den Eindruck erwecken, vorrangig um ihrer selbst zu existieren.
Freude bereitet Vinterbergs Parabel allein schon wegen ihrer technischen Perfektion und dem gekonnten Spiel mit Stimmungen. Abgesehen davon, dass der Film zum Ende hin stark nachlässt, muss man aber damit leben, dass er einfach viel weniger ist, als er zu sein vorgibt.
The Day of the Doctor – Kritik eines Unwürdigen
Aufmerksamen Lesern des Blogs ist vermutlich bekannt, dass dieses Doctor Who nicht ganz die Sache die Sache des Betreibers dieser Seite ist. Diesem Kreis von Leuten wird ebenso geläufig sein, dass dieses Urteil ein vielleicht verfrühtes ist, da hier bisher lediglich Staffel 1 des „neuen Stranges“ rezensiert wurde. Diese hatte mich so verschreckt, dass ich Stafel 2 nie beendet habe. Das ist die traurige Geschichte von Doctor Who und mir.
Unnötiges Vorgeplänkel
Richtig, ich hab Staffel 1 gesehen und mich gelangweilt. Wenn wir ehrlich sind, bekam sie sogar ein paar Pünktchen mehr, als ich ihr eigentlich gegeben hätte. Ich sah durchaus, welche Hebel von ihr wie umgelegt werden sollten – aber bei mir hat’s einfach nicht geklappt. Die Witze zu vorhersehbar, die Figuren zu dumpf, vor allem aber sind mir die Geschichten viel zu uninspiriert und langweilig gewesen, während eine Art übergeordnetes Storygerüst mir immer nur auf der Behauptungsebene zu existieren schien.
Jetzt mal Im Ernst, es ist ‘ne Serie über einen Kerl, der in einer Telefonzelle durch Raum und Zeit zuckelt und zwischendurch Bedrohungen von galaktischem Ausmaß abwehrt. Aufgezogen ist das Ganze als liebevoller Trash. Macht es abgedreht, macht es freaky, spacig, schräg, konfus und in höchstem Maße skurril! Verwirrt den Zuschauer; führt ihn vor; treibt Schabernack mit ihm und bezirzt ihn dazu, gemeinsam mit euch zu lachen. Schallend zu lachen! Vor allem aber möchte ich in einer Serie mit dieser Thematik und einem Potenzial, das zwangsläufig mit Zeitreisen daherkommt, dass dieses gefälligst auch ausgeschöpft wird. Zeitparadoxa, Zeitschleifen, neu eröffnete Zeitlinien, die sich kreuzen, miteinander verknoten oder gegen die Wand fahren, wo sie sich zerfasern und schließlich in Flammen aufgehen.
Was ich hingegen nicht will, sind blöde, unendlich zähe Geistergeschichten mit verlorenen Pointen in einem Erzählrhythmus, das derart holprig ist, dass man Gelenkschmerzen bekommt.
Auch die Trash-Masche zog bei mir nicht, das wirkte alles zu aufgesetzt und kalt. Aber viel wichtiger sind die ganz grundsätzlichen Erzählprobleme, das Was und das Wie.
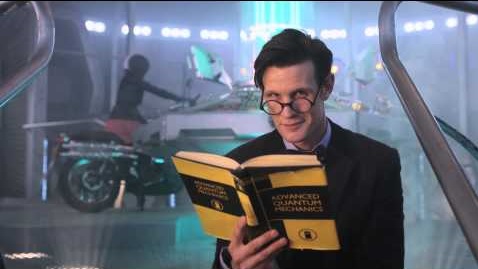
Deswegen folgte nie eine weitere Kritik zu einer Doctor Who-Staffel. Außerdem hatten die DVDs keine gescheiten Untertitel.
Und nun wird dieses komisches Phänomen 50 Jahre alt. Keine andere Science-Fiction-Serie ist derart langlebig, nicht einmal Star Trek. Und da das Franchise seit der Wiederaufnahme von BBC zum erfolgreichsten und prestigeträchtigsten Exportgut des englischen Königreichs avancierte, ließ man sich natürlich nicht lumpen und machte ein Riesenevent aus der Sache. Weltweit wurde am Jubiläumstag in ausgewählten Kinos The Day of the Doctor ausgestrahlt. In 3D. Und obwohl mein Erstkontakt mit der Kultserie ein gescheiterter war und mein Interesse daher eigentlich nicht vorhanden, führte mich eine seltsame Schicksalsfügung ins Kino.
Unqualifizierte Kritik
Da sitze ich also, am Geburtstag eines Fremden auf einer Party, deren Regeln ich nicht verstehe, und fühle mich wie jemand, der nicht eingeladen wurde, weil er ein Spielverderber ist und aus Bosheit trotzdem kam. 16 Euro für knapp 80 Minuten, drei Vorstellungen an diesem Tag und der Saal ist voll. Überall sitzen Leute in Kostümen, deren Referenzobjekte ich meist nicht kenne. Bei einigen war ich mir auch gar nicht sicher, ob es sich nun Verkleidung oder exzentrische Alltagstracht handelte. Ein ganzer Saal angefüllt mit Fans, die gierig mitsummen, wenn ein x-beliebiges Thema im Film angespielt wird, bedächtig raunen, wenn vielsagende Gesichter aufblitzen, und ausgelassen kichernd die Witze aufsaugen. In etwa so muss sich ein Pfarrer auf einer LAN-Party fühlen.
Die anfängliche Skepsis schien sich zu bestätigen. Da ist einer dieser späteren Doktoren, der feixend ins Bild stolpert und erzählt, dass nun ein 12D-Film folgen würde. Ach nein, oh je, haha, da hat er sich vertan, doch nur 3D, falsches Jahr. Immer diese Zeitreisen! Dieser schusselige, liebenswerte Doktor schon wieder. Zustimmendes Glucksen im Saal und meine vorurteilsinfizierten Befürchtungen beginnen sich zu manifestieren.
In erster Linie geschah aber genau das, was ich erwartet habe – ich kriege jede Menge Kram zu sehen, den ich nicht verstehe. Was erwartet man auch, wenn man als Unkundiger Fanservice in Spielfilmlänge konsumiert. Jesses.


Ein paar Dinge waren mir ja aber doch bekannt. Da ist dieser Timelord, der in seiner großgeschriebenen TARDIS, ein Akronym, durch Raum und Zeit düst. Wenn er stirbt, dann kommt die nächste Reinkarnation und ähnlich häufig werden seine menschlichen Begleiter ausgetauscht. Denn er mag Menschen. Und dann gibt es da diese sinistren Küchenroboter namens Daleks und den folgenschweren Timewar, der in der Vergangenheit gegen sie geführt wurde. Irgendeine Sache mit einem Bad Wolf war da außerdem und das ein oder andere Spezialdetail ist mir auch bekannt, obwohl ich ja nur diese eine läppische Staffel geschaut habe.
Vom Inhalt des Filmes wusste ich im Vorfeld nur, dass wohl drei Doktoren auf einmal auftreten, was gewiss allerhand Scherze und Verstrickungen verspricht. Nämlich Doktor Nummer 10, Doktor Nummer 11 und John Hurt als „War Doctor“. Wieso Nummer 9 ausgespart bleibt, hab ich nicht verstanden und verstehe ich immer noch nicht. Ein Fan murrte als Antwort nur, dass Christopher Eccleston wohl die unbeliebteste Verkörperung dargestellt haben soll. Finde ich glaubwürdig, nur den hab ich ja auch so richtig kennengelernt. Dafür gibt’s ja John Hurt als eine Art Spezial-Doktor und das macht mich glücklich.
Und siehe da, der britische Gentleman ist beileibe nicht der einzige Punkt, der mir am Film gefällt. Im Gegenteil. Rose Tyler, die ich als furchtbar enervierende Dumpfbacken-Begleiterin in Erinnerung behalten habe, ist plötzlich eine Art esoterischer Mad Max in weiblich. Nicht nur, dass sie nicht stört, es scheint auch so, als hätte Billie Piper zu spielen gelernt. Ihre kesse Rolle macht Spaß, wirkt glaubwürdig und bereichert den Film ungemein. Okay, so ganz Rose ist diese Rose wohl nicht, aber es versöhnt mich doch sehr mit dieser Figur. Ich verstehe nicht, was da passiert ist, aber mir gefällt es.
Auch die beiden Doktoren (nur Nummer 10 habe ich kurz mitbekommen) funktionieren bei mir. Das Zusammenspiel der Reinkarnationen ist charmant und heiter geworden, vom pseudo-melancholischen Fantastic!-Gealbere des neunten Doktors kaum keine Spur.


Viel wichtiger aber: Es gibt Zeitreisen en masse! Da wird hin und her gesprungen, ständig rutschen Gegenstände durch Verbindungen zwischen den Epochen und sogar ein wenig Konfusion ist dabei. Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft bedingen einander und wirken gemeinsam und durch ein bisschen Schummelei wird sogar der Zuschauer an der Nase herumgeführt. Nun gut, ein ordentliches Paradoxon bleibt uns weiterhin erspart, aber trotzdem, es geht doch!
Die Geschichte rast durch die knappe Spielzeit und hat trotz der epischen Breite, die so ein 50-Jahre-Jubiliäum wohl haben muss, immer den Schalk im Nacken. Der Trash ist zeitgemäß, korrekt dosiert und bewusst einpflegt, sodass alles wie aus einem Guss wirkt. Verschwunden ist die trottende Langeweile, die Staffel 1 dominiert hat.
Am Ende gibt’s dann noch einen rührselgien Cameo-Auftritt, der den Fans die Tränen in die Augen treibt, und alle sind glücklich.
Unfundiertes Resümee
Sicher, nicht alles ist perfekt, das Kalauer-Niveau vom 12D-Gag des Vorspanns wird zum Glück aber kein weiteres Mal angepeilt und alles andere ist liebevoll durchzuwinken. Da ist’s dann auch nicht weiter schlimm, dass die Geschichte nicht logisch aus sich heraus beendet wird, sondern auf eine große, ziemlich beliebig wirkende Deus ex machina-Lösung zurückgegriffen wird. Wirklich erschlossen hat sich mir auch nicht, was die Wiederkehr der zum letzten Mal in den 70ern aufgetauchten Formwandler-Monstrositäten eigentlich mit der Geschichte zu tun hatte. Ich vermute, das lässt sich auch gar gar nicht erschließen. Aber Mensch, was soll’s.
Die Fans waren selig und auch wenn ich überzeugt bin, nur einen Bruchteil von dem verstanden zu haben, was es zu verstehen gibt, weil mir sicherlich hunderte von Anspielungen einfach entgangen sind, hat mich allein das Gefühl glücklich gemacht, dass eine Serie da etwas Tolles und ungemein Dankbares für ihre Fans ins Kino bringt. Okay, für 16 Euro ins Kino bringt. Aber immerhin. Und 3D gab’s ja auch. Zu dem 3D kann ich übrigens nichts sagen, weil ich 3D nicht sehen kann. Aber das bleibt ein Geheimnis zwischen Dir und mir, werter Leser, da mich dieser Umstand natürlich dafür disqualifiziert, über viele andere Filme und ihren Effekt zu urteilen, was mich nicht davon abhält, es regelmäßig zu tun.
Unterm Strich bin ich nicht nur prächtig unterhalten und rundum zufrieden, sondern muss mir zwangsläufig auch die Frage stellen, ob ich Doctor Who nicht deutlich zu früh abgeschrieben habe. Irrational und sowieso gänzlicher Unfug ist dieser Text, der sich langnäsig mit „Kritik“ schmückt, weil all die Sympathie, die ich dem Film entgegenbringe, hauptsächlich von Annahmen rührt, die ich aufgrund meiner Serien-Unkenntnis gar nicht verifizieren kann. Aber ich lasse mich in dem Glauben und muss am Ende enttäuscht ermitteln: Ich mag ihn irgendwie doch, den Doktor.
Robocop – Internationaler Trailer
Ein weiteres Vorschauhäppchen, das die vorherrschende Skepsis, wie auch schon die vorangegangenen Einblicke, noch etwas mehr glättet. Ob die aus der Zeit gerissenen Motorradsprünge weniger prätentiös wirken, wenn sie in eine Geschichte gebettet sind, bleibt abzuwarten. Zum Rest muss man ein weiteres Mal sagen, dass er überraschend embitioniert und angenehm humorlos wirkt. Wie das Original.
Space Prey
Vor 10 Jahren gab es diesen kleinen Fan-Film über einen Mann im Fledermauskostüm, der sehr viel Aufmerksamkeit und Lob erfuhr. Sandy Collora hieß der Mensch hinter dem Projekt, dem nicht viel später der Trailer zum nonexistenten Batman/Superman-Treffen folgte. (Und nun kommt ein gewisser Zack Snyder und macht genau das). Und dann, 5 Jahre später, erscheint Herr Collhora wieder auf der Bühne und zwar mit einem abendfüllenden Spielfilm, der sich nicht explizit auf eine (Comic)vorlage stützt, aber gespickt ist mit Querverweisen.
I thought it was my charming personality.
Story
Ein Transporter stürzt auf einem lebensfeindlichen Wüstenplaneten ab. Die Fracht war ein gefährlicher Sträfling, der die Gunst der Stunde für seine Flucht nutzt. Das kleine Team von mürrischen Soldaten, welches sich zwecks seiner Bewachung ebenfalls an Bord befindet, kann nur mit Mühe vom Ranghöchsten zusammengehalten werden. Weder wurde man für eine solche Jagd bezahlt noch scheinen die Erfolgsaussichten sonderlich hoch, da der Planet weitläufig ist und der Gefangene nicht nur enorm gefährlich ist, sondern sich zudem die Anzeichen verstärken, dass es sich bei ihm keineswegs um einen normalen Sträfling handelt. Rasch rollen Köpfe und die Verfolgung spitzt sich auf eine Duellsituation zu, in der plötzlich viel mehr in Frage gestellt werden muss, als den Feinden lieb ist.
Kritik
Alles beginnt mit einem Darwin-Zitat, bedrohlicher Musik und flirrenden Farben. Der leiderprobte Filmgourmet möchte gerade schon das Schlimmste befürchten, da taucht plötzlich Boba Fett auf. Nein, mehrere Boba Fetts, die dazu auch noch mit dem Raumschiff namens Prometheus bruchlandeten, um sich in einer Situation zu verfangen, die stark an Enemy Mine erinnert.
Ja, wir nennen das mal wohlwollend Verbeugung vor den Großen und nicht plumpen Diebstahl, schließlich ist bekannt, dass der Macher allem voran Vollblutfan ist.
An dieser Stelle lässt sich auch schon ganz gut voraussagen, was der Film richtig und was er weniger richtig machen wird. Fans haben Ideen, sie sind Feuer und Flamme für ihre Sache, noch nicht in Routine verklebt und möchten in erster Linie ihrer Leidenschaft Ausdruck verschaffen. Fans haben aber in aller Regel auch einen schmalen Geldbeutel, kaum Erfahrung und in Konsequenz Erwartungen, denen sie selbst nur im seltensten Fall genügen können.
Doch der Reihe n ach. Beim richtigen Boba Fett im richtigen Star Wars wusste man, er ist Boba Fett, denn er ist der eine Mann mit der pikanten Weltraumrüstung. Space Prey (oder Hunter Prey, wie der Film im Original heißt, was die Frage aufwirft, wieso zum Marder man wieder mal ein englisches Wort durch ein anderes ersetzte) gibt uns gleich mehrere dieser behelmten Herren, was ein gewisses Verwechslungspotenzial birgt, denn bei einer Handvoll Leute in solchen Anzügen ist es eine Kunst für sich,, auszumachen, wer wer ist und wie dieser wer wiederum zu den anderen wers steht. Da die durch den Helm verfälschen Stimmen darüber hinaus alle sehr ähnlich klingen, ist davon auszugehen, dass man auch gar nicht wissen muss, welcher Soldat da gerade seine schlechte Dialogzeile runterbetet. Und siehe da, mit dieser Prognose liegt man goldrichtig, denn schon recht früh hat sich die Anzahl der Verfolger auf 1 reduziert und alles ist wieder so, wie es sein sollte: Der Mann im Boba Fett-Anzug ist ein einzelner.
Die Sache mit den dürftigen Dialogen verdient es, ausgeführt zu werden. Der Rezensent ist nicht informiert, was Nick Damon gemacht hat, bevor er an der Seite des Regisseurs das Drehbuch zu Space Prey geschrieben hat, er wagt aber die Vermutung, dass es nicht Drehbuchschreiben gewesen ist. Der Aufbau, ganz besonders aber die Dialoge erwecken den Anschein eines Erstlingswerks. Es fallen viel zu viele Sätze, die nur da sind, damit die Figuren nicht schweigen, und die doch besser ungesagt geblieben wären. Ob nun die schwer zu ertragenden Macho-Sticheleien der Soldaten untereinander oder eine klischeehafte Computerstimme, die kompetente Informationen wie „Atmosphäre dünn“ oder „Ihr Linker Arm ist ernsthaft verletzt“ leiert, ihrer Mikrochipnatur zum Trotz anfängt, Gefühle zu entwickeln, die diese schlussendlich dazu nutzt, sich von zwielichtigen Soldaten umschmeicheln zu lassen, um dann den Rest des Filmes spitzfindig mit diesem zu flirten.
Dann die audiovisuelle Seite: Vom eingangs erwähnten Kostümklau bzw. von der eingangs erwähnten Hommage abgesehen, beschränkt sich die Ausstattung auf einen großen Mondeffekt am Himmel, blass-blaue Alien-Echsen-Masken und ein „Scan-Brillen“-Effekt, den es in der Form auch schon vor 60 Jahren gegeben hat. Spielort ist die vollen 90 Minuten eine Wüste mit spärlichem Grasbewuchs und so schroffen wie langweiligen Felsen, in der sich seltsamerweise alles so anhört, als würde man in sich in einer Garage bemühen, Töne zu erzeugen, die nach Wüstenplaneten-Duell klingen sollen.
Merkwürdigkeiten wie ein Raumschiff, aus dem sich mit einem Schweißbrenner Stücke entfernen lassen, fallen gar nicht weiter ins Gewicht.
Als wäre dies der Unbill nicht genug, wird mit dem inszenatorischen Hackebeil gearbeitet. Furchtbar laute Musik und wiederkehrende Aufnahmen in heroisch-tragischer Pose auf einem Berghang im Sonnenuntergang, während man sich eine Szene zuvor noch kauernd darum sorgte, vom Feind entdeckt zu werden, sind die Regel. Auch abseits davon verhalten sich die Figuren keineswegs so, wie man es von Wesen erwarten würde, die eine gewisse Entscheidungs- und Lebenskompetenz für sich beanspruchen.
Wie man sieht, das volle Potenzial für eine Waschechte Niete. Und doch schlägt sich Space Prey angesichts der ihm nicht sehr gewogenen Ausgangssituation mehr als wacker. Sandy Collora möchte in dem spärlichen Drumherum in erster Line eine Geschichte erzählen und das tut er mit einer Konsequenz, der es manch anderen Filmen entschieden ermangelt. Irgendwie entsteht trotz seiner strunzdummen Dialoge, die fraglos den hässlichsten Makel darstellen, niemals Langeweile und es warten ein paar wirklich anständigen Wendungen, auch wenn diese auf dem krummen Rücken der Logik ausgeführt werden werden.
Space Prey ist sympathisch. In seiner Mängelumgebung entsteht entgegen aller Widrigkeiten so etwas wie Atmosphäre, die Figuren werden mit jeder Szene etwas interessanter und die gesamte Dynamik reift mit der Laufzeit beträchtlich. All das täuscht nicht über zahlreiche Fehler und Holprigkeiten hinweg, bürgt dafür aber mit einem sympathischen Indie-Charme, der tatsächlich für vieles entschuldigt und nach dem Abschluss das Gefühl vermittelt, einen netten Film gesehen zu haben, in dem sogar Aliens vorkommen.
Was den Sci-Fi-Streifen letztlich von vielen passablen B-Movies abhebt, ist das gar nicht so blöde Spiel mit der Fokalisierung, das es verdient hätte, an dieser Stelle viel weiter ausgeführt zu werden, worauf aber verzichtet wird, um dem geneigten Zuschauer nichts vorwegzunehmen.
Fazit
Space Prey ist eine sonderbare B-Movie-Mischung aus Psychothriller und Enemy Mine, der es gelingt, am Ende weit mehr zu sein als die Summe ihrer Teile. Wirkt es anfangs noch recht holprig und ausgesprochen billig, muss man unterm Strich doch anerkennend sagen, dass hier aus sehr wenig relativ viel gemacht wurde.
Ihr großen Studios da draußen, gebt dem Mann ein bisschen Zeit zum Üben und das Geld für eine Produktion jenseits der 420.000 Dollar. Er hat es nämlich. Wirklich.